
- 9 Minuten Lesezeit
Es gibt eine stille Selbstverständlichkeit, mit der wir durchs Leben gehen: Jetzt bin ich wach, also ist das hier real. Vorhin habe ich geträumt, also war das nicht real.
Wir sagen das, als wäre es eine physikalische Tatsache wie die Schwerkraft. Als müsste man darüber eigentlich gar nicht mehr nachdenken. Aber tatsächlich stimmt das so nicht. Gerade dann, wenn etwas völlig selbstverständlich wirkt, lohnt sich ein zweiter Blick.
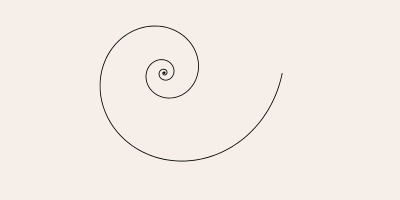
Was wir „Realität“ nennen, wirkt stabil, verlässlich, vorhersehbar. Der Tisch ist ein Tisch, die Wand eine Wand, und wenn wir uns den Zeh stoßen, tut es verlässlich weh.
Träume dagegen zerfließen, springen, widersprechen sich und sind vor allen Dingen nicht vorhersehbar. Sie halten sich nicht an Logik, sie folgen nicht der Zeit und Identitäten sind darin austauschbar.
Wir bewerten sie als nett, interessant, manchmal verstörend – aber eben nicht wirklich real. Doch diese Trennung ist weniger naturgegeben, als wir glauben. Sie ist eher ein kulturelles Abkommen. Und sie beginnt zu bröckeln, wenn man ernsthaft hinschaut.
Wie unser Gehirn die Realität erfindet

Die moderne Gehirnforschung zeigt uns ziemlich unmissverständlich, dass wir die Welt nicht so wahrnehmen, wie sie ist, sondern so, wie unser Gehirn sie konstruiert. Was wir sehen, hören, fühlen und denken, ist das Produkt massiver Filterprozesse. Sinnesreize werden aussortiert, verstärkt, abgeschwächt, ergänzt und interpretiert.
Unser Gehirn ist also kein Fenster zur Welt, sondern ein Hochleistungs-Simulator. Wir nehmen keine fertigen Dinge wahr, sondern Fragmente:
- Lichtreize
- Schallwellen
- Druck
- chemische Signale
Diese Rohdaten sind für sich genommen bedeutungslos. Erst unser Gehirn setzt sie zusammen, ergänzt Lücken, ordnet sie ein und formt daraus ein stimmiges Bild der Welt.
Eine Welt mit festen Dingen, klaren Grenzen, einer kontinuierlichen Zeitlinie und einer durchgehenden Identität. Eine Welt, in der Objekte beständig bleiben, Ursachen zuverlässig Wirkungen haben und wir selbst als dieselbe Person von einem Moment zum nächsten existieren.
Diese Stabilität ist kein Merkmal der Welt an sich, sondern eine Leistung unseres Gehirns.
Sie entsteht, weil alles Widersprüchliche geglättet, alles Unklare vereinfacht und alles Fehlende automatisch ergänzt wird, bis das Gesamtbild stimmig genug ist, um sich darin sicher zu fühlen.
Dieses Bild fühlt sich für uns an wie „das, was ist“, wie Realtiät, die existiert. Tatsächlich ist es aber ein Modell. Ein sehr effizientes, sehr überzeugendes Modell, das vor allem einem Zweck dient: Orientierung und Handlungsfähigkeit.
Unser Gehirn fragt nicht, wie die Welt wirklich ist, sondern wie sie für uns sinnvoll funktioniert.
Ein beträchtlicher Teil dessen, was existiert, fällt dabei schlicht durchs Raster, weil er für unser Überleben und unseren Alltag keine Rolle spielt. Realität ist also nicht vollständig, sondern radikal gefiltert.
Ein Großteil dessen, was „da draußen“ existiert, erreicht uns nie. Wir sehen nur einen winzigen Ausschnitt des elektromagnetischen Spektrums, hören nur einen schmalen Frequenzbereich, nehmen nur wahr, wofür wir Aufmerksamkeit, Sprache und innere Kategorien haben. Und selbst das, was wir wahrnehmen, ist dann noch eingefärbt von
- Erfahrung
- Erwartung
- Emotion
- Fokus
Zwei Menschen können in derselben Situation stehen – und in völlig verschiedenen Welten leben, ohne dass eine davon „falsch“ wäre.

Nicht metaphorisch, sondern neurobiologisch: Jeder bekommt dieselben Reize, aber das Gehirn verarbeitet sie anders. Es wählt aus, verstärkt, interpretiert, ergänzt und filtert – und zwar basierend auf Erfahrung, Erwartungen, Emotionen und Aufmerksamkeit.
Am Ende entsteht für jeden eine eigene, stimmige Version der Realität, die sich für ihn völlig „echt“ anfühlt und dennoch können beide Versionen sich sehr unterscheiden.
Die Erkenntnisse der Quantenphysik zeigen diesen Gedanken noch präziser. Auf kleinster Ebene gibt es keine festen Dinge, sondern nur Wahrscheinlichkeiten. Situationen und Zustände klären sich erst, wenn wir mit ihnen in Kontakt treten oder sie bewusst wahrnehmen.
Wir sind keine neutralen Zuschauer in einer bestehenden Welt, sondern Teil des Geschehens und Mitschöpfer derselben.
Was wir sehen, wie wir etwas wahrnehmen und wie wir uns einbringen, beeinflusst direkt, wie sich die Dinge zeigen und damit auch, wie sie sind.
Realität ist hier kein statisches Objekt, sondern ein Prozess, ein Zusammenspiel aus Potenzial und Wahrnehmung. Die Vorstellung einer festen, objektiven Welt, die völlig unabhängig von uns existiert, ist veraltet und nicht mehr haltbar.
Träume und Wachwelt: Zwei Seiten derselben Medaille

Und was ist nun mit unseren Träumen, wenn es keine objektive feste Welt gibt?
Träume funktionieren nach denselben Grundprinzipien wie unsere Wahrnehmung der sogenannten Realität. Auch hier erzeugt das Gehirn aus Bruchstücken von Sinneseindrücken, Erinnerungen und Emotionen eine Welt, die sich für uns stimmig anfühlt.
Der Unterschied liegt darin, dass viele der üblichen Filter wegfallen: Zeit und Raum können sich dehnen oder springen, Identität und Geschehnisse folgen nicht der Logik unserer Welt im Wachzustand. Alles ist offener, direkter und oft ungefilterter.
Aber woher kommen diese Filter eigentlich?
Sie sind das Ergebnis von Erfahrung, Lernen und Anpassung. Von klein auf hat das Gehirn gelernt, wie die Welt funktioniert: welche Abläufe wahrscheinlich sind, welche Regeln in der Gesellschaft gelten, welche Muster überlebenswichtig sind.

Auf dieser Basis sortiert es fortlaufend Informationen, gleicht Widersprüche aus, ignoriert Unwichtiges und hebt Relevantes hervor. Das alles geschieht automatisch und in Millisekunden, ohne dass wir es merken. Deshalb wirkt die Wachwelt so konsistent, stabil und berechenbar – weil unser Gehirn sie ununterbrochen glättet, ergänzt und organisiert.
Im Traum fallen diese Filter weitgehend weg. Das System arbeitet freier, ungezwungener, weniger angepasst. Deshalb erscheinen die Traumwelten offener, direkter, manchmal bizarrer – und doch entstehen sie auf derselben Grundlage wie alles, was wir als „Realität“ bezeichnen.
Es gibt also keinen festen Maßstab, nach dem die Wachwelt automatisch „echter“ wäre als die Traumwelt. Beides wird vom Gehirn konstruiert, nur auf unterschiedliche Weise: die Wachwelt mit starken, gesellschaftlich erlernten Filtern und Regeln, die Traumwelt freier und weniger angepasst.
Aber „wirklich“ oder „unwirklich“ sind sie deshalb nicht – beides sind Wahrnehmungen, die unser Gehirn für uns erzeugt, die genauso Illusion wie Wirklichkeit sind.
Warum Träume keine Einbildung sind

Gefühle im Traum sind real. Angst, Trauer, Freude, Aufregung – sie sind physiologisch messbar, sie hinterlassen Spuren im Nervensystem. Der Körper reagiert, das Herz schlägt anders und Hormone werden ausgeschüttet. Zu sagen, das sei „nicht real“, ist absurd.
Es ist real erlebt, real verarbeitet und real wirksam. Der einzige Grund, warum wir Träume oft als „weniger echt“ ansehen, ist, dass sie nicht stabil genug sind, um von allen gleichzeitig erlebt oder verstanden zu werden. Sie lassen sich schwer teilen.
Aber seit wann ist Mehrheitsfähigkeit ein Kriterium für Wahrheit? Warum soll die Meinung anderer entscheiden, was für uns echt ist?
Vielleicht sind Träume nicht weniger real, sondern weniger angepasst. Sie sind nicht auf Nützlichkeit getrimmt, nicht auf Produktivität, nicht auf gesellschaftliche Anschlussfähigkeit.
Sie sprechen in Symbolen, Verdichtungen und Bildern. Und manchmal sagen Träume Dinge, die im Wachzustand keinen Platz haben. Das hat nichts damit zu tun, dass sie falsch wären, sondern eher damit, dass sie vielleicht zu direkt, zu ehrlich oder zu intensiv sind, um von unserem Gehirn mit den Begrenzungen unseres Wachzustands verarbeitet zu werden.
Gefühle, Gedanken oder Einsichten, die zu unangenehm, widersprüchlich oder beunruhigend wären, werden im Alltag oft ausgeblendet oder umgedeutet. Im Traum hingegen fallen diese Filter weg, und alles, was da ist, kann sich zeigen.
Ist das nicht am Ende eine wirklichere Wirklichkeit als der kulturelle soziologische Filter unseres Wachzustands?
Wenn wir verstehen, dass sowohl Wachwelt als auch Traumwelt Konstruktionen unseres Gehirns sind, öffnet sich eine ganz andere Perspektive. Die Welt, die wir im Alltag erleben, ist nicht einfach „da draußen“ existent, sondern eine Version, die unser Gehirn erschafft und die uns hilft, uns zurechtzufinden.
Träume zeigen dagegen, wie flexibel diese von uns erschaffene Version eigentlich ist. Sie lassen uns erkennen, dass unser Erleben jederzeit anders geformt werden könnte, dass unsere Wahrnehmung nicht fixiert, sondern veränderbar ist.
In diesem Sinn sind Träume nicht nur gleichwertig zur Wachwelt, sondern vielleicht sogar ehrlicher: Sie legen die Mechanismen offen, die unsere Vorstellung von „Realität“ überhaupt erst erschaffen. Unsere Wirklichkeit existiert niemals unabhängig von uns – sie entsteht ständig neu, durch unsere Wahrnehmung und unser Erleben, ob wir wach sind oder träumen.
Das Ende der Sicherheit: Wenn das Weltbild wankt

Vielleicht ist die eigentliche Frage also nicht, ob Träume real sind. Sondern warum wir so große Angst davor haben, ihnen diesen Status zuzugestehen.
Denn in dem Moment, in dem Träume real werden dürfen, verliert die sogenannte Realität ihr Monopol. Und das ist für ein Weltbild, das gern so tut, als hätte es alles im Griff, eine ziemlich beunruhigende Vorstellung.
Es ist die Angst davor, dass die Ordnung, an die wir uns klammern, nur eine Konstruktion ist, die wir für stabil halten, weil sie uns Sicherheit gibt. Wenn Träume denselben Status wie die Wachwelt bekommen, wird deutlich, dass unsere Realität nicht absolut, sondern jederzeit veränderbar, flexibel und teilweise unkontrollierbar ist.
Plötzlich bricht die Illusion weg, dass wir alles vorhersehen, alles verstehen und alles steuern können. Alles, was wir für feste Regeln und unumstößliche Abläufe halten – unsere Zeit, unsere Identität, unsere Wahrnehmung von Ursache und Wirkung – entpuppt sich als etwas, das genauso formbar ist wie ein Traum.
Die beunruhigende Erkenntnis ist also nicht nur, dass Träume „real“ sein könnten, sondern dass unsere gesamte Vorstellung von Stabilität und Sicherheit im Alltag jederzeit in Frage gestellt werden kann.
Diese Erkenntnis ist zugleich beängstigend und befreiend. Beängstigend, weil sie die Sicherheit untergräbt, auf die wir uns im Alltag verlassen.
Wenn die Ordnung von Zeit, Ursache und Wirkung, Identität und die Verlässlichkeit der Dinge nicht feststeht, verliert unser gewohntes Weltbild seinen festen Boden, und wir spüren, wie fragil alles ist, was wir als „wirklich“ ansehen.

Aber genau darin liegt auch eine enorme Freiheit. Wenn wir verstehen, dass Realität immer eine Konstruktion ist, eröffnet das neue Möglichkeiten: Wir können die Art und Weise, wie wir die Welt erleben, bewusster wahrnehmen, hinterfragen und gestalten.
Träume werden so zu einem Spiegel für diese Freiheit – sie zeigen, dass unser Leben und unsere Erfahrungen nicht festgeschrieben sind und dass wir selbst die Regeln bestimmen, nach denen wir Wirklichkeit erleben.
Das eröffnet die Möglichkeit, die Welt freier zu erleben, jenseits aller gewohnten Grenzen, und zu erkennen, dass „real“ und „unreal“ nicht Gegensätze sind, sondern zwei Seiten derselben Erfahrung.
Genau darin liegt unsere Macht, dass wir unsere Wahrnehmung, unsere Gefühle und unsere Welt aktiv gestalten können, bewusst oder unbewusst, wach oder träumend, und dass jede Entscheidung, jeder Gedanke, jede Erfahrung Teil dieser fortwährenden Kreation unseres Lebens ist.
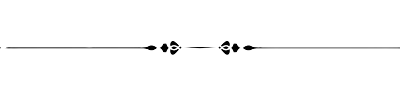
Entdecke mehr von Garten der Seele
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.